„Böse, raffinirt, fatalistisch“ - Deutsche Oper Berlin
Aus dem Programmheft
„Böse, raffinirt, fatalistisch“
Anselm Gerhard über Bizet und das gebrochene Pathos der großen Oper
„Durch Bizet gewann die Carmen-Fabel den Rang des Archetypischen […]. Angesiedelt ist diese Fabel im Spanien der Zigeuner: in einer potenzierten Szenerie aus südländischer Leidenschaftlichkeit und unbehauster Ursprünglichkeit.“ Was Karl Schumann, ein viel gelesener deutscher Musikkritiker, im Beiheft zu einer 1976 erschienenen Einspielung schrieb, steht exemplarisch für eine weit verbreitete Interpretation einer der erfolgreichsten Opern der Theatergeschichte: „In CARMEN schuf Georges Bizet ein Stück Natur. Es verweist ihn […] in die Reihe der den ‚Verstandesgenies’ entgegengerichteten ‚Naturgenies’.“

Hält man sich zudem vor Augen, wie oft Bizets letzte Oper als realistisch oder gar veristisch bezeichnet wird, scheinen die Dinge eindeutig: Die Verstrickungen typisierter Figuren in grausame Liebesbeziehungen sind mit einer Einfühlung abgebildet, die uns guten Gewissens die Schnupftücher aus den Taschen kramen und in der fatalen Tragik einer tödlichen Intrige schwelgen lässt. Eine solche eindimensionale Lesart von Bizets „opéra comique“ funktioniert reibungslos, wie unzählige Inszenierungen immer wieder aufs Neue bewiesen haben. Der anhaltende Erfolg dieser eigentümlichen Partitur ist zu einem wesentlichen Teil darin begründet, dass Meilhacs, Halévys und Bizets Personendarstellung es dem Zuschauer erlaubt, sich unmittelbar und je nach Geschmack mit einer der tragisch wirkenden Hauptfiguren zu identifizieren.
Betrachtet man allerdings die Umstände der Entstehung und die zeitgenössische Rezeption, drängen sich erhebliche Zweifel daran auf, ob die Dramaturgie der drei erfahrenen Theaterkünstler tatsächlich auf Pathos und Identifikation zielte. Bizet, der Spanien übrigens nie gesehen hatte, war alles andere als ein unreflektiertes „Naturgenie“. Als typischer Pariser seiner Zeit war er denselben Versuchungen der Melancholie und der Depression ausgesetzt wie ein Berlioz, Baudelaire oder Flaubert. Bereits als Zweiundzwanzigjähriger pflegte er einen Zynismus, der späterer Desillusionierung im tatsächlichen Leben gar nicht mehr bedurfte, um sich mit dem Skeptizismus der schwarzen Romantik zu treffen. In den zwei Jahren als französischer Stipendiat in Rom verbrachte er seine Zeit unter anderem mit Bordell-Besuchen, die er fein säuberlich im Tagebuch verzeichnete. Zu jener Zeit schrieb er seinem Cousin: „Ich erkläre meine Inkompetenz in Ehedingen. Ich verdamme verständnislos jeglichen Überschwang dessen, was man Liebe nennt.“
Gewiss: Neun Jahre später sollte er mit der Tochter seines Kompositionslehrers Fromental Halévy, der Cousine eines der CARMEN-Librettisten, vor den Standesbeamten treten. Liest man die überlieferten Briefe, wird man jedoch kaum von einer romantischen Liebesheirat sprechen wollen. Sieht man, welche Spannungen sich bald in dieser Ehe manifestierten, scheint es fast, als habe der junge Bizet mit der Einschätzung eigener „Inkompetenz“ recht behalten.
Auch die beiden Librettisten, Henri Meilhac und Ludovic Halévy, waren alles andere als Naturburschen, denen es um die spontane Umsetzung „südländischer Leidenschaftlichkeit“ zu tun gewesen wäre. Ihre Spezialität waren vor Wortwitz sprühende Texte für „opéras bouffes“, mit denen sie gnadenlos die Verlogenheit der Pariser Gesellschaft bloßstellten. Fast alle großen Operetten Jacques Offenbachs sind auf Texte dieses pointensicheren Autorenteams komponiert; selbst Johann Strauß’ DIE FLEDERMAUS geht auf eine Vorlage der beiden Bühnenprofis zurück.
Als Libretto, das sich nicht von vornherein als bitterböse Parodie ausweist, ist CARMEN dagegen ein Einzelfall in ihrem Schaffen geblieben. Freilich hält uns einer der frühesten CARMEN-Enthusiasten im deutschen Sprachraum dazu an, unsere Einschätzung des Werks als herzzerreißendes Melodram zu überdenken. Sicherlich bediente sich Friedrich Nietzsche der französischen Oper vor allem als plakatives Gegenmodell für seine Abrechnung mit Richard Wagner. Aber was er über die Partitur schreibt, ist gleichwohl bedenkenswert: „Diese Musik ist böse, raffinirt, fatalistisch: sie bleibt dabei populär […]. Sie ist reich, sie ist präcis. […] Ich weiss keinen Fall, wo der tragische Witz, der das Wesen der Liebe macht, so streng sich ausdrückte, so schrecklich zur Formel würde, wie im letzten Schrei Don José’s, mit dem das Werk schliesst.“
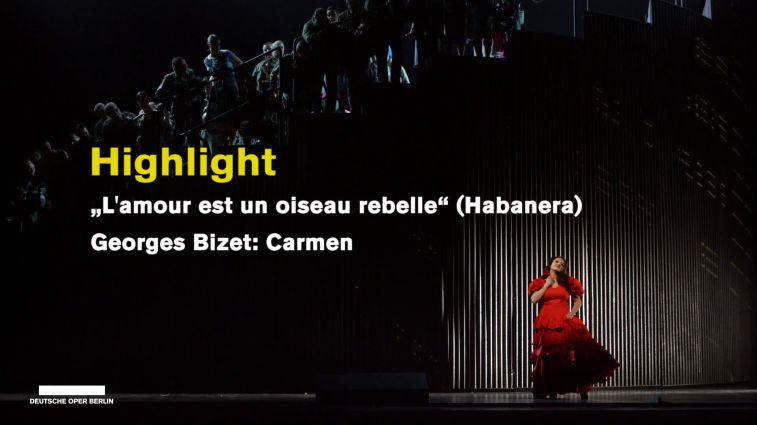
„Tragischer Witz“
Hier sollen also entschiedene Zweifel angemeldet werden an vorherrschenden CARMEN-Interpretationen. Die Betrachtung poetischer und kompositorischer Techniken in ausgewählten Schlüsselszenen zeigt, wieviel Raffinesse, wieviel „tragischer Witz“, ja wie viele bisweilen fast parodistische Untertöne in dieser Bearbeitung einer 1847 erschienenen Erzählung Prosper Mérimées verborgen sind. Natürlich mag man einwenden: CARMEN ist doch kein Stück von Offenbach! Die Musik teilt doch offenbar die emotionalen Erschütterungen ihrer Protagonisten! Selbstverständlich tut sie das. Aber vielleicht sollte man trotzdem etwas genauer hinhören. Denn alles in dieser Oper, in der Meilhacs und Halévys Text an keiner Stelle von Bizets Musik getrennt werden kann, ist doppelbödig.
Kaum eine Musiktheaterproduktion ist so weit gegangen im Versuch, das, was seit Friedrich Schlegel als „romantische Ironie“ bezeichnet wird, in seiner Grausamkeit, aber auch in seiner Lächerlichkeit offenzulegen.
Vor einem Missverständnis muss allerdings gewarnt werden: Eine ausgelassene Parodie sentimentaler Verstrickungen ist dieses Stück sicher nicht. Stattdessen wird ein Grundprinzip „romantischer Ironie“ in unzähligen Details verwirklicht: Jede Situation, jede Regung der Figuren wird gleichzeitig voller Empathie dargestellt und doch tragisch gebrochen. Meilhacs und Halévys Libretto sowie Bizets Musik sind nicht nur „böse“, sie zeigen auch, dass erst durch die Distanzierung von den lächerlichen Begrenzungen menschlicher Lebensumstände deren ganze Tragik greifbar wird.
Nonsense zur Eröffnung
Das Spiel mit Tonfällen, die einem Operntext völlig unangemessen sind, beginnt bereits im Eingangschor: „Sur la place | Chacun passe, | Chacun vient, | Chacun va; | Drôles de gens que ces gens-là.“ [„Auf dem Platz geht jedermann vorbei, jeder geht, jeder kommt; seltsame Leute, diese Leute da.“] Extrem kurze, nur drei Silben umfassende Verse täuschen eine Atemlosigkeit vor, die so gar nicht zur gelangweilten Beschreibung eines eintönigen Alltags passen will. Der Reim der prosaischen Worte „place“ und „passe“ wird kaum einen poetischen Schönheitspreis gewinnen können. Und die rhythmische Beschleunigung im Doppelvers „Chacun vient, | Chacun va“ greift ganz ungeniert das alltagssprachliche „va-et-vient“ [„Kommen und Gehen“] auf, freilich in einer Umkehrung, die den Sprachfluss erst recht zum Holpern bringt.

© Marcus Lieberenz
Jenseits solcher Raffinessen im ‚poetischen’ Detail irritiert vor allem, was man als dramaturgischen Offenbarungseid bezeichnen muss. Wenn es einen mehrere Minuten dauernden Chor braucht, um dem Publikum mitzuteilen, dass auf einem belebten Platz in einer Großstadt zur Mittagszeit ein ständiges Kommen und Gehen herrscht, gibt es nur zwei Erklärungsmöglichkeiten: Entweder waren die drei Autoren unfähig, einen passenden Einstieg in die dramatische Handlung zu finden. Oder aber sie wollten sich über eine der überkommenen Opernkonventionen lustig machen. In der Tat hatte es sich seit Rossini durchgesetzt, Opern mit einer dramatisch mehr oder weniger gut begründeten Chorszene zu eröffnen. Ob es dabei um Vorbereitungen zu einer Hochzeit oder um ein rustikales Trinkgelage ging, spielte kaum eine Rolle. In einer Librettoparodie, die Antonio Ghislanzoni 1870, genau zeitgleich mit seinen Versen zu Verdis AIDA verfasste, lesen wir: „Am Beginn einer Oper singen wir, wie es Brauch bei uns ist, aus der Ferne ein Gebet oder einen Trinkspruch…“
Kaum je ist wohl derart kaltblütig das Sinnlose einer Konvention bloßgestellt worden, die sich auf das Prinzip bewegten Stillstands reduzieren lässt. Es scheint, als würden Meilhac und Halévy ihrem Publikum zuzwinkern: „Ihr wollt einen Eingangschor? Wir wissen zwar nicht, warum. Und eine brauchbare Idee haben wir auch nicht gefunden. Aber wenn es nur darum geht, die Zeit zu füllen: Hier habt Ihr einen Chor!“

© Marcus Lieberenz
In Moralès’ Solo ist ausdrücklich davon die Rede, „die Zeit totzuschlagen“ [„Pour tuer le temps“]. Noch ohrenfälliger ist Bizets musikalische Gestaltung dieses Chors: Eine andere solide Konvention des Musiktheaters des 19. Jahrhunderts bestand nämlich darin, dass herausragende dramatische Ereignisse mit einem lang ausgehaltenen Orgelpunkt vorbereitet werden. Ein besonders frappantes Beispiel unter Hunderten denkbarer Exempel findet sich am Beginn von Webers DER FREISCHÜTZ, wenn der Kadenzschritt von der Dominante zur Tonika genau gleichzeitig mit dem erfolgreichen Schuss im Schützenwettbewerb erfolgt.
Auch Bizets CARMEN setzt mit einem solchen Orgelpunkt ein. Nur folgt auf die Dominante keine Tonika, sondern gleich die nächste Zwischendominante – zur Subdominante. Dem Nonsense des Librettos entspricht ein ebenso sinn- wie zielloses harmonisches Mäandern, das angesichts der überstürzten, mit zwei Sechzehntelnoten vor einer ausgehaltenen Viertel umherstolpernden Rhythmik des gesungenen Textes noch zusätzlich verstört. Als wollte uns der Komponist sagen: „Ihr wartet auf irgendein Ereignis? Ich auch. Aber die Librettisten haben mir keines gegeben. Irgendwie muss also auch ich die Zeit totschlagen.“
Damit aber immer noch nicht genug: Wenn schon der Inhalt eines Eröffnungschors gleichgültig sein mag, so war doch eine seiner dramaturgischen Funktionen unverzichtbar. Er breitete die Folie aus, vor der – mit einer auf den Film vorausweisenden Technik des „Heranzoomens“ – eine wichtige Figur exponiert werden konnte. So wurde in die erste Chorszene regelmäßig das erste Solo der zweitwichtigsten Person des Dramas eingelagert – in einer Oper mit einer weiblichen Titelfigur wie CARMEN wäre das die männliche Hauptrolle: Don José.
Warten auf José
In der Tat fällt Don Josés Name bereits im Mittelteil des erwähnten Eröffnungschors. Doch muss Micaëla [und mit ihr das Publikum] feststellen, dass der sehnlich erwartete Solist [noch] gar „nicht da ist“. Moralès präzisiert: „Er wird da sein, wenn die aufziehende Wache die abtretende Wache ablösen wird.“ Und da wir inzwischen für jede Perspektive dankbar sind, die anderes bietet als die schwüle Mittagshitze Andalusiens, wiederholt der Chor diese grundstürzende Aussage mit Aplomb – zusammen mit Micaëlas Ankündigung, sie „werde wiederkommen, wenn die aufziehende Wache die abtretende Wache ablösen wird“.
Warten wir nun also auf die „garde montante“, die „aufziehende Garde“. Auf Trompetensignale aus der Kulisse folgt erneut ein Chor. Doch singen nicht Wachsoldaten, sondern Straßenjungen, die die Bewegungen des Wachbataillons karikieren und so ihr böses Spiel mit der Autorität des Militärs treiben. In die Mitte dieses [zweiten] Chors ist wieder ein Wortwechsel eingelagert – in der von Bizet vollendeten Fassung als gesprochener Dialog, in der nach seinem Tod angefertigten Bearbeitung Ernest Guirauds ein knappes Rezitativ: Moralès berichtet José, dass Micaëla nach ihm gefragt hat. Doch wieder bleibt der Zoom auf José flüchtig, ein Solo wird ihm ebenso verweigert wie zuvor Micaëla. Ist José am Ende gar keine Hauptfigur? Eine weitere Chance scheint sich im Dialog mit seinem Vorgesetzten, dem frisch nach Sevilla versetzten Leutnant, zu bieten. Aber statt nun endlich von sich selbst zu sprechen, etwa mit einem Lied, das von den schönen Arbeiterinnen in der Zigarettenfabrik singt, dabei aber unterstreicht, wie sehr er in Micaëla verliebt ist, beantwortet José einsilbig und pflichtschuldig die Fragen nach dem Fabrikgebäude. Es folgt ein weiterer Chor, derjenige der „cigarières“ mit dem metaphorischen Akzent auf „fumée“, auf „Rauch“: Alle Beteuerungen von Liebe sind „fumée“, also „heiße Luft“. Und endlich, endlich löst sich aus diesem dritten Chor ein Solo – freilich dasjenige Carmens. Sie hebt mit ihrer Habanera an, Bizets Arrangement eines 1864 in Paris publizierten Lieds des baskischen Komponisten Sebastián de Yradier y Salaverri.

Doch auch wenn José seit Beginn der Oper [fast] stumm geblieben ist: Selbst hier steht er [indirekt] im Fokus. Carmen wirft ihm zwischen den beiden Strophen ihres Lieds über die Flüchtigkeit der Liebe eine „fleur de cassie“, eine Akazienblüte [übrigens ein verbreitetes Attribut von Prostituierten] zu. Diese Blume, die José – so seine Bemerkung in der Dialogfassung – „wie eine Kugel zwischen die Augen“ getroffen hat, wird uns noch beschäftigen.
Eine „komische“ Oper?
Auch wenn der Hinweis auf Waffengewalt bereits das blutige Ende vorausahnen lässt: CARMEN – so sagt es der Gattungstitel – ist eine „opéra comique“. Das bedeutete 1875 allerdings nicht viel mehr, als dass das Stück für diejenige Pariser Bühne bestimmt war, auf der üblicherweise „opéras comiques“ aufgeführt wurden, also Opern, in denen zwischen den musikalischen Nummern keine gesungenen Rezitative, sondern gesprochene Dialoge vorgesehen waren. „Durchkomponierte“ Opern dagegen waren nach den strengen Vorgaben der französischen Kulturverwaltung ein Privileg der seit 1875 im Palais Garnier spielenden großen Oper und einiger anderer Theater.
In den Jahrzehnten nach der Französischen Revolution waren jedoch die inhaltlichen Grenzen zwischen leichteren und tragischen Genres immer mehr aufgeweicht worden. So hatte man bereits 1859 die tragische Geschichte von MANON LESCAUT als „opéra comique“ gegeben, wenn auch mit einer beschönigenden Abschwächung des unbarmherzigen Ausgangs. Das Komische in dem Sinne, wie es die deutsche Sprache dem Wort zuweist, war dagegen nach 1855 definitiv in Häuser wie Offenbachs Théâtre des Bouffes-Parisiens abgewandert.
Dennoch: Ein so unumwunden hässliches und grausames Sujet wie CARMEN bedeutete auch noch 1875 eine erhebliche Provokation, wie zahlreiche empörte Kritiken bezeugen. Dieser Stilbruch trug wesentlich dazu bei, dass der Oper zunächst kein Erfolg beschieden war. In einem der Pariser Uraufführungsberichte lesen wir [und man könnte ein Dutzend ähnliche Urteile zitieren]: „Es war freilich kein ungefährliches Wagnis, eine derart traurige Vorlage und einen derart tragischen Ausgang auf die Bühne zu bringen, überdies an der Opéra Comique. Die Figur der Heldin, die im Roman einen Vorteil daraus zieht, dass in der Erzählung nicht alles gesagt wird, konnte in der realistischen Gewandung des Theaters hassenswert und unannehmbar erscheinen. Eine Carmen aus Fleisch und Blut war nicht mehr die phantastische, aber doch poetische Carmen Prosper Mérimées. Diese Manon Lescaut der Gosse, die nicht einmal mit dem Abglanz der Empfindung ihrer Vorgängerin bemäntelt wird, dieses Mannweib in schmutzigen Kleidern und mit unzüchtigen Liedern, die sich dem Erstbesten ohne Scham anbietet, war sie wirklich statthaft, wenn sie gestikulierend sprach? Konnte gar der spanische Des Grieux, der von vornherein dem Galgen bestimmt ist, Interesse erwecken?“

Angesichts der Tatsache, dass sich nach 1860 große Oper und „opéra comique“ in der Stoffwahl allenfalls noch hinsichtlich des sozialen Milieus, nicht aber in der Konstruktion tragischer Intrigen unterschieden, kam der Unterscheidung zwischen durchkomponiertem musikalischen Kontinuum und gesprochenem Dialog eine umso größere Bedeutung zu. Und genau hier verfügten Komponisten über nuanciert einsetzbare Stilmittel, um verschiedene Tonlagen einer Aussage zu markieren – vom einfachen Prosadialog über gereimte oder melodramatisch begleitete Sprache bis hin zu Rezitativ und Arie. So ist es alles andere als unschuldig, wenn Bizet seinen José in der von ihm hinterlassenen Fassung genau dann zum ersten Mal singen lässt, als ihm Micaëla von seiner Mutter berichtet.
Der erste Auftritt des Tenors
Mitten in der Reaktion auf Micaëlas Botenbericht aus der Heimat wechselt José vom Sprechen [beziehungsweise vom Rezitativ] in den Gesang: „Ma mère. Parle-moi de ma mère ! Parle-moi de ma mère !“ [„Meine Mutter. Sprich mir von meiner Mutter! Sprich mir von meiner Mutter!“] Aber was für ein Gesang! Für einen Des Grieux [Manon Lescauts Geliebten] aus der spanischen Provinz greift er spürbar eine Tonlage zu hoch, wenn er nicht einen einfachen Dreiklang umschreibt, sondern gleich voller Emphase einen nach Moll eingefärbten verminderten Septakkord und dann gar einen Septnonenakkord aufschichtet. Noch auffälliger als diese harmonischen Details ist aber die inhaltliche Aussage. José bemerkt nicht, dass Micaëla mit ihm flirten möchte, er ist in Gedanken an seine ferne Mutter gefangen.
Ein Muttersöhnchen also. Sollen wir wirklich glauben, weltläufige Pariser des 19. Jahrhunderts hätten eine einfältige Figur ernstgenommen, die sogar beim Kuss einer attraktiven Frau gleich an die eigene Mutter denkt? Ein Jüngling, der blind und taub dafür ist, dass für das Mädchen, das vor ihm steht, die Geschichte von dem Kuss, den sie von der Mutter zu überbringen habe, nur ein willkommener Vorwand für ganz andere Absichten ist? Ein Soldat aus der Provinz, dessen einzige Reaktion auf die Avancen einer jungen Schönheit im heimeligen Singen „Ma mère, je la vois“ [„Meine Mutter, ich sehe sie vor mir“] besteht?
José begreift nicht, dass „cette autre chose“, dass „diese andere Sache“ eben nicht nur wörtlich als Kuss der Mutter zu verstehen ist, sondern genauso als ironisches Spiel mit moralischen Verboten – wir werden auf den „raffinirten“ Einsatz des unpoetischen Worts „chose“ in diesem Libretto zurückkommen. Aber auch im vierten Anlauf singt José kein Solo, sondern ‚nur’ ein Duett – mit dem Mädchen aus der Heimat, das begreifen muss, dass sie keine Chance gegen Carmens erotische Reize haben wird. Der tumbe Wachsoldat wird als willen- und bewusstloser Spielball der Launen des Schicksals eingeführt.

Der Tenor setzt sich in Szene
Erst am Ende des zweiten Aktes haben die Opernmacher José ein Solo zugestanden. Nun will er Carmen nicht mehr gehen lassen. Er sieht keine andere Wahl, als sich in die heldische Pose des Tenors zu werfen, um die begehrte Frau an sich zu binden. Freilich handelt es sich bei dem Solo, das wir als „Blumenarie“ bezeichnen, gar nicht um eine selbständige Solonummer, sondern um einen Abschnitt des großen Duetts zwischen Carmen und José. Dabei bezwingt José nicht nur seine eigene Schüchternheit. Er tut auch Carmen Gewalt an. Die – auch hier wieder ungewöhnlich genaue – Szenenanweisung präzisiert, er packe mit einer brutalen Geste ihren Arm, um sie zum Zuhören zu zwingen.
Musikalisch greift José dabei nach den Sternen. Nachdem alle naiven Beteuerungen bei Carmen nichts ausrichten konnten, wechselt er ins pathetische Register der großen Oper. Die Musik dazu hatte Bizet seiner nicht vollendeten Oper GRISELIDIS entnommen. Anstelle zweier parallel gebauter Strophen, wie von den Librettisten vorgegeben, komponiert Bizet eine Arie, in der die strophische Gliederung verschleiert wird. Die Tonart Des-Dur steht für höchste emotionale Erregung, der Beginn der Singstimme auf der exponierten hohen Terz für äußerste Anspannung. Weit geschwungene melodische Bögen und affektierte Vorhalte lassen den Abglanz großer Oper aufscheinen. Doch die Form ist gleichsam eine Nummer zu groß für diesen Helden aus der Provinz. Die Ironie springt ins Ohr, wenn wir auf Bizets Musik hören.
Die sinnliche Terz am Beginn jeder Phrase bleibt flüchtiger Reiz, sie wird aufgesogen von abwärts gerichteten Bewegungen. Der desertierte Soldat fühlt sich wie in einen Strudel heruntergezogen: Carmen zuliebe ist er zum Kriminellen geworden. Es wäre ein Leichtes für Bizet gewesen, die Erinnerung an die Akazienblüte des ersten Aktes [„La fleur que tu m’avais jetée“] und den Ausruf „ma Carmen“ auftaktig zu komponieren. Aber er lässt seinen José lieber falsch skandieren, mit hässlichen, groben Betonungen auf „la“ und „ma“. Im Bemühen, die geborgte Form dieser geborgten Romanze zu einem rhetorischen Höhepunkt zu zwingen, versagt dem einfachen Brigadier vom [Basken-]Lande endgültig das beschränkte Vokabular. Er stammelt: „Et j’étais une chose à toi.“ [„Und ich war ein Objekt für Dich.“]
Das ist zwar nicht so obszön, wie wenn der englische Thronfolger seiner Geliebten [und heutigen Ehefrau] ins Telefon flüstert, er wolle am liebsten ihr Tampon sein, in diesem lyrischen Kontext aber mindestens genauso unangemessen. Auch hier legt Bizet das Verfehlen der angemessenen Stilhöhe gnadenlos durch musikalische Mittel offen: Auf die emphatische Sexte zum Textwort „toi“ folgt nicht die Quinte in hoher Lage, sondern eine – Generalpause. Der tenorale Elan bricht in sich selbst zusammen. Die anschließende Liebeserklärung folgt nicht in der strahlenden Lage der hohen Tenorstimme, sondern eine Oktave tiefer. Die pathetische Geste ist ironisch gebrochen.
Ein weiterer Konventionsbruch
Es ist gewiss kein Zufall, dass Bizet Tonart und Melodik dieser „Blumenarie“ in der Finalszene wieder aufgreift und zwar genau dann, wenn José letzte verzweifelte Versuche unternimmt, Carmen für sich zurückzugewinnen. Der lyrischen Emphase in Des- und As-Dur kontrastieren Josés ungeschlachte Betonungen „ma Carmen“ und „te sauver“. Dabei zeigt die Titelheldin in einer ihrer letzten Repliken, wie man eine ‚richtige’ Liebeserklärung zum ‚richtigen’ Ende bringt: Im Des-Dur der „Blumenarie“ bekräftigt sie ihre Liebe zu Escamillo mit einer Kadenz in höchster Lage: „Je répéterai que je l’aime.“
Die Avancen Josés hat sie dagegen ein weiteres Mal zurückgewiesen. Seinem larmoyanten b-Moll setzt sie in schneidendem G-Dur ihr trotziges Bekenntnis zur Freiheit entgegen: „Libre elle est née et libre elle mourra.“ [„Frei ist sie geboren und frei wird sie sterben.“] Dabei bricht Bizet sogar mit einer damals noch selbstverständlichen Konvention der Textvertonung. Er lässt Carmen in dieser Replik das „e caduc“, also die unbetonte Endsilbe des Wortes „né-e“ nicht regelgerecht auf einer eigenen Note deklamieren. So wird noch im kleinsten Detail der Prosodie deutlich, dass diese Frau sich um keine Konventionen schert.
Genau deswegen braucht sie auch keine Arien, sondern singt durchweg nur einfache Strophenlieder. Aber was für Strophenlieder! Sie muss sich nicht bitten lassen, verzichtet im Zweifelsfall sogar auf [große] Worte. Am Beginn des großen Duetts mit José trällert sie nur „la, la, la“, sich selbst mit Kastagnetten begleitend.
Zum „tragischen Witz“ dieser einzigartigen Oper gehört eben auch, dass zwischen den beiden Hauptfiguren im wahrsten Sinne des Wortes eine Sprachlosigkeit herrscht, die in Josés Eifersuchtsmord gipfelt: Vor der Stierkampf-Arena weiß er nicht anders zu reagieren wie in einem Stierkampf auf Leben und Tod.

„Gerechte“ Strafen?
Insofern scheint – zumindest im blutigen Finale – doch etwas von ursprünglicher Leidenschaftlichkeit zu spüren. Schon in den ersten Kritiken der Oper zeigte sich, dass Bizets Musik zumindest für diejenigen Hörer Identifikationsangebote eröffnet, die musikalische Oberflächen zum Nennwert zu nehmen gewohnt sind. Aber – und das bestätigt uns die von feministischen Denkfiguren beeinflusste Wahrnehmung dieser Oper in den letzten vier Jahrzehnten – solche Identifikationsangebote können offensichtlich ganz unterschiedlich gefüllt werden.
In einer Pariser Uraufführungskritik lesen wir: „Im Roman ist Carmens Untergang in der Tat nichts als die gerechte Strafe für all die Verbrechen, die sie José hat begehen lassen […]; hier [in der Oper] dagegen, wo sie für keinen einzigen Toten verantwortlich ist und lediglich einen der Liebelei zugeneigten Soldaten zur Desertion verführt hat, stirbt sie fast auf ungerechte Weise, denn der wirkliche Schuldige ist derjenige, der sie tötet.“
Dagegen zog ein Kritiker der Berliner Erstaufführung von 1880 den genau entgegengesetzten Schluss: „Carmen kann auf jeden Zuschauer, der Herz und Gemüt noch nicht eingebüsst hat, nur abstossend wirken, und man gönnt ihr den gerechten Dolchstoss des durch sie elend gemachten José ohne Bedauern.“ Die Oper eignet sich also als Projektionsfläche für bürgerlichen Biedersinn genauso wie für emanzipatorische Bilder von einer „femme libre“. Die katholisch-liberale Abendzeitung „Le Français“ akzentuierte 1875 wiederum die grundlegende Ambivalenz der als langweilig und missraten eingeschätzten Oper: „In einem Wort: Ein Theaterstück nach Mérimées Carmen konnte ergreifende Anteilnahme und düsteren Schrecken bieten. Die Bearbeiter wollten dies abschwächen, um diejenigen zu unterhalten, die sich amüsieren wollen, und diejenigen für sich zu gewinnen, die weinen wollen.“
Da diejenigen, die bei der Betrachtung von CARMEN „weinen wollen“, immer wieder sehr zuvorkommend bedient werden, sei festgehalten, dass diese Oper mit erhabener Tragik ebenso wenig zu tun hat wie mit irgendeinem Realismus. Vielmehr gewinnt sie ihre Verve daraus, dass sie mit ironischen Brüchen verzweifelte Situationen viel „präciser“ abbildet als durch das hemmungslose Drücken auf die Tränendrüsen.




